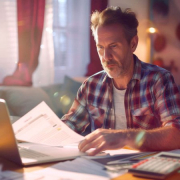Sanierungsmaßnahmen: Diese Förderprogramme gibt es
Eigentümer stehen vor hohen Kosten, wenn sie ihre Immobilien energetisch sanieren möchten. Dabei kann eine Modernisierung die Energiekosten deutlich senken und den Immobilienwert steigern. Um diese finanzielle Last zu mildern, gibt es vielfältige Förderprogramme. Die Förderungen müssen Eigentümer zunächst beantragen, und zwar vor der D. Investitionen dürfen meist erst nach dem Erhalt des Förderbescheids getätigt werden. Durch die „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) können Eigentümer zum Beispiel Zuschüsse für unterschiedliche Maßnahmen wie Heizungserneuerungen und Dämmungsarbeiten erhalten. Diese können bis zu 70 Prozent der Kosten abdecken.
Ein weiterer Anreiz wird durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geboten, das unter anderem die Modernisierung der Gebäudehülle fördert. Hier können Eigentümer bis zu 20 Prozent der Kosten erstattet bekommen. Nicht zuletzt kann durch steuerliche Absetzbarkeit ein zusätzlicher finanzieller Vorteil genutzt werden: 20 Prozent der Sanierungskosten (maximal 40.000 Euro pro Wohnobjekt) lassen sich über drei Jahre hinweg steuerlich geltend machen.
Trotz der Unterstützungen kann der Weg durch den Förderdschungel komplex sein. Hier kommen Energieberater ins Spiel. Sie helfen nicht nur bei der Antragstellung und stellen sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, sondern können auch von der BAFA bezuschusst werden. Mit Umsicht und professioneller Unterstützung können Eigentümer sicherstellen, dass sie die maximale Förderung für ihre Investitionen erhalten.
© immonewsfeed